
Veröffentlichungen
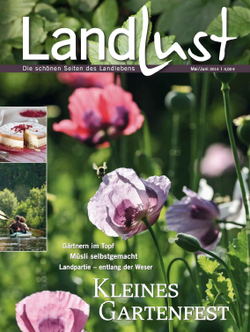
ALTER GLANZ
Leinölfarbe hat sich über die Jahrhunderte als Anstrich für drinnen und draußen bewährt. Sie lässt sich leicht auffrischen und entwickelt über die Jahre eine würdevolle Patina.
Landlust, Mai/Juni 2014

Holz im Außenbereich
Das gestiegene Umweltbewusstsein, aber auch die Bestimmungen der Lösemittelverordnung führen momentan zu einer Renaissance der Leinölfarbe ohne Lösemittel für Anstriche auf Holz.
Restauro, 10/2012
DAS NACHÖLEN VON ÖLFARBEN -
DIE PFLEGE VON LEINÖLFARBEN AUF BEWITTERTEN HOLZTEILEN MIT LEINÖL
Eine Annäherung über Quellen und Feldexperimente
Vorgelegt von Claude Caviglia
Fachbereich Konservierung und Restaurierung Master of Arts in Conservation - Restauration, Vertiefung: Architektur, Ausstattung und Möbel, Referent: Dr. phil.-nat. Stefan Wülfert, HKB, Koreferent: Rest. Johannes Mosler, Hadamar DE, Abschluss: Herbstsemester 2017
Abstrakt
Die vorliegende Masterthesis setzt sich mit der Pflege von Leinölfarben auf Holz im Aussenbereich mittels Leinöl auseinander. Sie soll dazu beitragen, dass das Nachölen in seiner Wirkung wie auch Nebenwirkungen als Massnahme zur Pflege und Konservierung von Leinöl- Anstrichen besser verstanden wird. Das Nachölen wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts empfohlen. Heute erlebt die Leinölfarbe und das Nachölen ein Revival.
Im Rahmen der Arbeit wurden zehn verschiedene Fachpersonen aus dem Bereich der Restaurierung und des Malerhandwerks zum Thema «Nachölen» interviewt und historische wie zeitgenössische Literatur erschlossen. An Probeobjekten konnten exemplarisch Versuche durchgeführt und ausgewertet werden.
Aus dem erarbeiteten Wissensstand zum Nachölen kann gefolgert werden, dass das Nachölen als Methode der Erhaltung von Ölfassungen im Aussenbereich aus konservatorisch-restauratorischer Sicht auch heute durchaus in Frage kommt.
Ergänzt wird die Arbeit durch eigene Empfehlungen und Erfahrungen betreffend dem Nachölen von Leinölfarbe im Aussenbereich. Es geht dabei hauptsächlich um den idealen Zeitpunkt des Einsatzes, welcher für Erfolg oder Misserfolg entscheidend sein kann.

Abb. 1: Nachölen eines Torflügels des Kloster Eschenbach LU: Das Halböl (rohes Leinöl) wird mit einem Pinsel aufgetragen. Der Unterschied zwischen nachgeölt und unbehandelt ist gut sichtbar. (M. Hüppi, Standbild aus Filmaufnahme, 2017)


Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Nachölen bewitterter, ölgefasster Holzbauteile im Aussenbereich und konzentriert sich dabei auf Leinölfassungen und den Einsatz von Leinöl als Konservierungsmittel.
Vorgehensweise
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich dem Leinöl als Rohstoff. Ein Überblick erläutert die Rohstoffgewinnung von Leinöl, welche Produkte daraus entstehen und wie diese trocknen und degradieren.
Als nächstes wurde die Leinölfarbe thematisiert. Neben Anwendungsgeschichte, Funktion und Alterungs-Phasen runden zwei Exkurse über die Farbigkeit des Holzwerkes und über das Holz im Aussenbereich dieses Kapitel ab. Das dritte Thema behandelt das Nachölen als Methode. Neben einer Begriffsklärung wurde eine vertiefte Recherche der historischen Literatur durchgeführt, bei einzelnen Institutionen nachgefragt, Interviews mit Fachpersonen geführt und ausgewertet.
Die Arbeit schliesst mit einer Evaluation zum Nachölen als Konservierungsmethode für die heutige Praxis. Dazu wurden Proben vor und nach dem Nachölen von Testobjekten entnommen und im kunsttechnologischen Labor der HKB analysiert. Diese Analysen ermöglichten erste Einblicke in die Wirkungsweise des Nachölens.
Abb. 3: REM-SE-Aufnahmen des Bauteiles «Türfragment UF» vor und nach dem Nachölen, 250-fach (links) und 3000-fach (rechts) vergrössert: Zwischen Vorzustand und nachgeölt sind die Unterschiede gut zu erkennen. Die Korngrenzen werden mit dem Nachölen unscharf und die Vertiefungen erscheinen wie aufgefüllt. (N. C. Scherrer, zusammengestellt durch?C. Caviglia, 2017)
Ergebnisse
Licht und Feuchtewechsel begünstigen unter Bewitterung einen beschleunigten Abbau. Damit wird klar, dass die Erfahrungen aus dem Innenbereich sich nur bedingt auf den Aussenbereich übertragen lassen.
Die Interviews mit Fachpersonen erwiesen sich als wichtige Quellen neben den wenigen schriftlich überlieferten Quellen. Daraus lässt sich «Nachölen» als Bezeichnung für die Methode als Fachbegriff vorschlagen.
Bei der Evaluation des Nachölens konnten nur exemplarische Anwendungen erprobt und dokumentiert werden. Materialanalysen waren nicht oder nur wenig erfolgreich. An einigen Oberflächen fand man Oxalatschichten,die möglicherweise das Eindringverhalten beeinflussen. An REM-Aufnahmen konnte man immerhin erwünschte Oberflächenveränderungen durch Nachölen aufzeigen. Auf der Basis des erarbeiteten Wissensstands zum Nachölen kann gefolgert werden, dass das Nachölen als Erhaltungsmethode für bewitterte Ölfassungen auf Holz im Aussenbereich aus konservatorisch- restauratorischer Sicht durchaus in Frage kommt. Dabei lassen sich auch erste Empfehlungen, beispielsweise zum richtigen Zeitpunkt des Nachölens geben, die für den konservierenden Erfolg der Methode bedeutsam sein könnten. In erster Linie hofft diese Arbeit allerdings, Material als Grundlage für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu stellen.
MUSTERGÜLTIG RESTAURIERT: GUTSHAUS IN ZARCHLIN
Das wahre Gesicht eines Hauses
Ein interessanter Beitrag aus der der „Monumento", dem Magazin für Denkmalkultur der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (Februar 2023)
Das fast vollständig erhaltene Fenster in einem Gutshaus in Mecklenburg-Vorpommern wurden gerettet und aufgearbeitet.
Zwangsentlüftung im Keller, Plastik als Füllung in der Doppelmauer – es waren diese Begriffe, die die Bauherren bei Beratungen so sehr schreckten, dass sie erst einmal innehielten und ihre Planungen überdachten. Sollte ein Gebäude nicht lange stehen können? Mit Materialien gebaut und restauriert worden sein, die sich über Jahrhunderte bewahrt haben? Die Antworten auf diese Fragen kannten Marianne und Daniel Krüger aus Berlin eigentlich schon, nun ging es um die Umsetzung.
Zarchlin, Gutshaus © Roland Rossner, Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Vorher: Fast wären die unterschiedlich gut erhaltenen historischen Fenster aus verschiedenen Gründen entsorgt worden.
2017 hatte das Paar in der Ferienregion Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern ein Haus gekauft. Das Gutshaus Zarchlin in Barkhagen, 1879 in Ziegelbauweise gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingsunterkunft, Schule und Konsum genutzt, hat es schwere Zeiten verkraftet. Es ist wieder ein Ort der Begegnung geworden, mit Gästeunterkünften und eigener Wohnung, Musikprobenraum und Werkstatt, zentralem Gemeinschaftsbereich mit Küche.
„Die Geschichte mit den Fenstern, die hat uns dazu gebracht, uns mit den alten, vorhandenen Materialien auseinanderzusetzen“, sagt Marianne Krüger. Darum ging es: Die Fassaden des Gutshauses sind klar gegliedert – mit 101 Fenstern. Einscheibenfenster an der Südseite, Kastenfenster an der Nordseite, in der Größe so unterschiedlich wie im Erhaltungszustand. Die Bauherren hätten gute Gründe gehabt, sich für einen Austausch zu entscheiden. Der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gelang es mit ihrer Beratung, sie davon abzuhalten. Schließlich prägen Fenster den Eindruck eines Hauses so maßgeblich wie die Augen ein Gesicht.

Zarchlin, Gutshaus © Roland Rossner, Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Nachher: Intensive Beratung und Anleitung verhinderten den Verlust der historischen Fenster. Gutes Raumklima und einfache Pflege sind die Folge.
Der Fensterrestaurator Johannes Mosler brachte ihnen und ihren Handwerkern auch die Leinölkonservierung nahe, mit der das Eindringen von Wasser verhindert wird. So entfallen aufwendige Reparaturanstriche und komplizierte Pflege. Nicht nur der Nachstrich erübrigt sich, sondern auch die Zwangsentlüftung.

Zarchlin, Gutshaus © Roland Rossner, Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Auf Vermittlung von Guido Siebert (DSD, 3. von links): Daniel (links) und Marianne Krüger sowie ein Handwerker bei der Fensterrestaurierung mit Johannes Mosler (hinten rechts).
Im direkten Vergleich werden das Ausmaß der Schäden und die Güte der Arbeit besonders eindrucksvoll:
........vor der Restaurierung
© Roland Rossner, Deutsche Stiftung Denkmalschutz

© Roland Rossner, Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Julia Greipl
Wir freuen uns auf Sie!
-
Kontakt
Telefon +49 (0)6433-94 32 61
Mobil +49 (0)1522 430 13 72
Mo - Fr 09.00 - 17.00
Email info@derleinoelladen.de
-
Besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft
Der Leinölladen
Dreimannsgasse 2
65589 Oberzeuzheim -
Öffnungszeiten Ladengeschäft
Mo, Mi, Do: 13.00 – 17.00
Gerne können wir auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen Termin vereinbaren.


